Bianca hat nie kandidiert – und war plötzlich Frau Bürgermeisterin
Vorarlberger Gemeindewahl
Seit zehn Jahren ist Moosbrugger-Petter Chefin einer kleinen Vorarlberger Gemeinde, hat sich aber nie für dieses Amt aufgestellt. Das ist nur im “Ländle” möglich

Am 15. März 2015 sitzt Bianca Moosbrugger-Petter im Rathaus von Reuthe und versteht die Welt nicht mehr. Sie ist Mitglied der Wahlbehörde und zählt die Stimmzettel der Gemeindewahl mit aus – in einem 630-Seelen-Dorf im tiefen Bregenzerwald sind dabei eigentlich keine Überraschungen zu erwarten. Doch diese Wahl ist anders.
Denn im Laufe der Auszählung kristallisiert sich heraus: Moosbrugger-Petter hat mit 196 die meisten Stimmen erhalten, 46 mehr als der amtierende Bürgermeister von Reuthe. Also wird sie kurz darauf von der Gemeindevertretung zur Bürgermeisterin gewählt und ist es bis heute. Und das, obwohl sie nie als solche kandidierte. Möglich ist das durch eine Eigenheit des Vorarlberger Wahlsystems, die seit Jahrzehnten umstritten ist und von der eigentlich primär Männer profitieren.
Leere Stimmzettel
307.890 Menschen sind am Sonntag wahlberechtigt, wenn im “Ländle” die Gemeindewahlen über die Bühne gehen. In den 96 Ortschaften werden die Gemeindevertretungen neu gewählt – so heißen dort die Gemeinderäte. Hinzu kommen Bürgermeister-Direktwahlen. Vor allem in den Städten gibt es aufgeheizte Wahlkämpfe, für die ÖVP geht es oftmals um ihre schwarze Machtbasis.
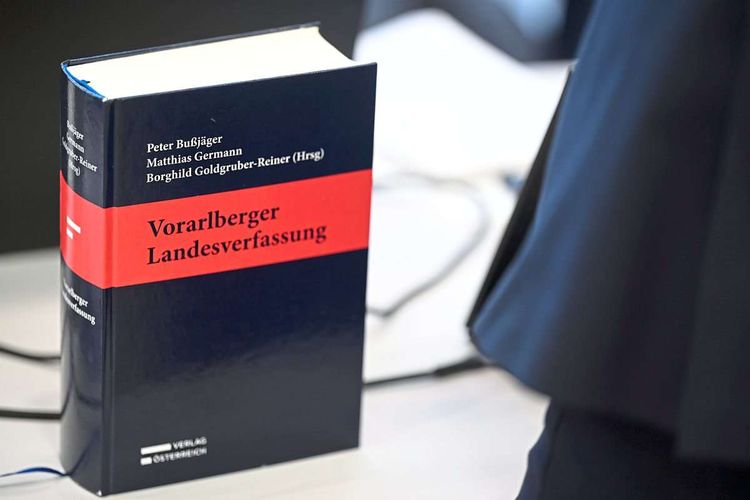
Doch in 13 Gemeinden – in den meisten davon leben weniger als 1000 Menschen – hat sich keine einzige Liste zur Wahl aufstellen lassen. In Tirol gilt in einem solchen Fall der amtierende Gemeinderat als wiedergewählt. In Vorarlberg aber findet auch in den 13 Ortschaften eine Wahl statt. Alle Wahlberechtigten können jede Wahlberechtigte auf den leeren Stimmzettel schreiben – maximal doppelt so viele Namen, wie Mandate zu vergeben sind. Die mit den meisten Stimmen schaffen es in die Gemeindevertretung.
Im Auftrag der Gemeinde
Diese Vorarlberger Praktik ist ein österreichweites Unikat mit Ursprüngen im Kaiserreich und wurde 1984 vom Verfassungsgerichtshof abgeschafft, weil es im Widerspruch zum vorgeschriebenen System der Verhältniswahlen stand. Aber Vorarlberg kämpfte um sein Alleinstellungsmerkmal und bewirkte zehn Jahre später eine Verfassungsänderung. Die Mehrheitswahl wurde wieder möglich und bei den Gemeindewahlen 2000 erstmals wieder angewandt – bis heute.
So etwa in Reuthe. DER STANDARD trifft dort Bürgermeisterin Bianca Moosbrugger-Petter im Gemeindehaus, einem Holzbau an der Landesstraße, in dem neben der kleinen Gemeindeverwaltung auch Kinderbetreuung und Volksschule untergebracht sind. Sie sei von ihrem Wahlsieg 2015 überrascht gewesen, sagt sie, aber sei sich dann nach kurzer Bedenkzeit sicher gewesen, Bürgermeisterin werden zu wollen: “Diese Stimmen waren ja ein Auftrag der Gemeinde. Die hat sich das gewünscht, dass ich das Amt übernehme.”
Nicht angestrebtes Amt
Doch wie kam dieser Auftrag zustande? Warum erhält eine vergleichsweise junge Frau die meisten Stimmen, obwohl der Amtsinhaber bleiben wollte? Der durchschnittliche Gemeindevertreter war bei der letzten Wahl schließlich 47, Moosbrugger-Petter bei ihrem ersten Wahlsieg 2015 erst 38 Jahre alt. Sie kann sich das bis heute – zehn Jahre später – nicht ganz erklären. Da ist zwar eine jahrzehntelange Verbundenheit zu den Vereinen im Ort, zur Musik, zum Skiverein. Da ist der Zusammenschluss “meor Rüthingar Froua” – oder auf Deutsch: “Wir, die Frauen von Reuthe” –, wo schon einmal Thema gewesen sei, dass man sich mehr Gemeindevertreterinnen wünsche. Aber ohne Wahlkampf, den es in Gemeinden mit Mehrheitswahl nicht gibt, auf Platz eins?

Eine Rolle dabei könnte spielen, dass sich Bianca Moosbrugger-Petter in den Aufgaben einer Gemeinde auskennt. Die Buchhalterin war für fünf Jahre Gemeindesekretärin und in dieser Funktion ständig mit dem halben Dorf im Kontakt, bevor sie 2005 zum Gemeindeverband wechselte. Und sie saß in der Periode vor ihrem Überraschungserfolg schon für fünf Jahre in der Gemeindevertretung. Doch, und das beteuert sie: Sie habe das Amt nicht angestrebt.
“Oh, nein, lieber nicht!”
Damit geht es ihr genauso wie vielen anderen Frauen. Martina Rüscher, Landesrätin und Vorsitzende der Vorarlberger ÖVP-Frauen, hat vor der Gemeindewahl versucht, Kandidatinnen zu gewinnen – und war damit oft nicht erfolgreich: “Männer haben ein großes Selbstverständnis, wenn wir fragen, ob sie kandidieren wollen. Sie sagen: ‘Super, endlich hast du mein Talent entdeckt!'”

Bei Frauen sei das anders: “Sie haben Zweifel, ob sie alle ihre Rollen gleichzeitig sehr gut ausfüllen können”, sagt Rüscher dem STANDARD. So befürworte sie auch Quoten für Wahlvorschläge oder würde sich sogar gegen eine verpflichtende paritätische Zusammensetzung von Gemeindevertretungen “nicht wehren”. Dazu wirft Moosbrugger-Petter aber ein, dass es für sie in Reuthe eine Herausforderung wäre, sechs Frauen für zwölf Mandate zu finden: “Egal, mit wem ich geredet habe, sie haben gesagt: ‘Oh, nein, lieber nicht, das machen andere viel besser.'”
Weniger Frauen
Dass dieses Gefühl weiter sehr verbreitet ist, zeigt auch die Statistik: Der Frauenanteil in mittels Mehrheitswahl bestimmten Gemeindevertretungen (Wahl 2020: 19 Prozent) ist deutlich geringer als in Gemeinden, in denen zumindest eine Liste zur Wahl stand (27 Prozent). Neben Moosbrugger-Petter lenken nur zwei weitere Frauen im zwölfköpfigen Gremium die Geschicke von Reuthe. Das Volk treffe seine Entscheidung aber so weise, dass alle Ortsteile, alle Vereine, alle Gruppen gehört würden, sagt Moosbrugger-Petter. Parteipolitik brauche es dafür keine.
Dennoch spricht sich auch Wolfgang Weber von der FH Vorarlberg im STANDARD-Gespräch für eine Quotenregelung aus: “So traurig diese Einschränkung des Wahlrechts wäre, so sehr würde sie zu einem höheren Anteil von Frauen in den Kommunalparlamenten führen.” Der Historiker ist Mitherausgeber eines Buches über die Geschichte der Gemeindewahlen im “Ländle”, dem auch einige der Statistiken für diesen Text entnommen sind.
“Wiege der Demokratie”
Eine Quotenregelung würde aber wohl das Ende des Mehrheitswahlrechts bedeuten. Für Historiker Weber wäre das ein Kollateralschaden: “Die Kernidee von Demokratie ist, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten und einen ideologischen Wettbewerb der besten Ideen haben. Und den nehme ich bei der Mehrheitswahl weg.” Das sei ein Problem: “Die Gemeinden gelten auch heute noch zu Recht als Wiege der Demokratie. Ich sehe als Bürgerin, dass ich unmittelbar Einfluss nehmen kann. Ohne Wettbewerb geht dann etwas verloren.”

Der gehe in Reuthe aber nicht unter, sagt Bürgermeisterin Moosbrugger-Petter: “In der Kleinheit, in der wir sind, kommt man mit Anliegen schon zu mir.” Auch würden Bürgerbeteiligungsverfahren stattfinden – und dadurch in der Gemeindevertretung dann die allermeisten Entscheidungen einstimmig getroffen werden. Aber sie sagt auch: “Für Wahlkampf bin ich nicht so der Typ. Entweder sehen sie, was ich das ganze Jahr über arbeite. Oder halt nicht.”
Und: “Ich bin gerne Bürgermeisterin. Aber wenn den Job morgen jemand anderes tun mag, dann ist das halt so.” (Maximilian Werner aus Reuthe, 12.3.2025)
>read more at © Der Standard
Views: 0